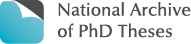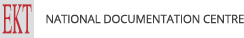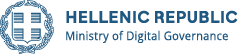Abstract
The thesis examines whether Thomas Bernhard's "Auslöschung" ["Extinction"] can be seen as a literary theory of decay in the sense of Emile Cioran's "Precis de decomposition" ["Lehre vom Zerfall", "A short history of decay"].So far there is no other related systematic contrasting study carried out between the works of the two authors. There are only rare and extremely brief references to the possible affinity in the overall and general spirit of thought of the two authors. The thesis focuses on the subtitle "Ein Zerfall" ["A Collapse/ A decay"] of Thomas Bernhard's novel "Auslöschung" ["Extinction"] and demonstrates that despite the fact that it seems like a mere addition by the author that can easily be overlooked by the reader, it emerges as a potentially fundamental means of guiding his attention and a key to decoding the entire novel. In this context, it is systematically investigated what exactly the term "Zerfall" can refer to, what is the semantic field of this term. The German t ...
The thesis examines whether Thomas Bernhard's "Auslöschung" ["Extinction"] can be seen as a literary theory of decay in the sense of Emile Cioran's "Precis de decomposition" ["Lehre vom Zerfall", "A short history of decay"].So far there is no other related systematic contrasting study carried out between the works of the two authors. There are only rare and extremely brief references to the possible affinity in the overall and general spirit of thought of the two authors. The thesis focuses on the subtitle "Ein Zerfall" ["A Collapse/ A decay"] of Thomas Bernhard's novel "Auslöschung" ["Extinction"] and demonstrates that despite the fact that it seems like a mere addition by the author that can easily be overlooked by the reader, it emerges as a potentially fundamental means of guiding his attention and a key to decoding the entire novel. In this context, it is systematically investigated what exactly the term "Zerfall" can refer to, what is the semantic field of this term. The German term Zerfall, which can be translated as decay, encloses and includes various related concepts such as collapse, decomposition, sepsis, corruption. First, the different forms of decay that appear in the novel are categorized, and examined in light of Cioran's short history of decay in the light of the following questions: What is the relationship between the concept of decay as applied in the novel and the corresponding concept in the philosophical text? Can the manifestations of sepsis be identified in both works? Do they follow the same logical pattern, do they complement each other, or are they in contrast with each other? In each section of the thesis a comparative experiment is conducted, in which the range of meanings of the concept of decay, defined as decay, material decay, spiritual decay is examined and whether the two works together can, in a sense, constitute a complete textbook for teaching the concept of decay. The starting point of the investigative study is the obvious fear of the literal sense of decay that the protagonist of the novel Murau experiences, when he loses his family, which exceeds the fear of death in intensity. The main nuances of decay in Extinction are systematically examined and analysed in relation to Cioran's text. For example, the questions are explored, whether the ambiguous macabre ideas of immersion in the observation of decaying matter and whether decomposition processes could lead both authors step by step to recovery from the delirium of death, as there is evidence of this hypothesis in the work of both. Sickness as a factor leading to the decay of the body is a common theme in both works. In this context, it is in contrast to the notion of common sickness that "sickness unto death" ("Todeskrankheit") is predominantly examined, while Soren Kierkegaard's corresponding term is being examined in this systematic study. The basic view of the protagonist of "Extinction" is that constant movement is necessary to avoid stagnation and the resulting decay. In Cioran's philosophical text, on the other hand, continuous movement is derogatively referred to as "impulse/mania for action" [CIO 11]. In the light of Cioran's argument about the "sanctity of inaction" [CIO 59], it is studied whether there is a gap in the approach to these terms in the two works and whether the terms boredom, the appetite for action, inertia, stillness, ataraxia, acedia as carriers of the fundamental terms of quietness and restlessness are used in a similar way in both works despite their seemingly glaring and obvious differences. The question is investigated whether quietness and restlessness with their related terms are in the end really unequivocal terms in both plays or whether this is not the case after all. The comparison of the use of these terms with a systematic study of the continuous reconstruction or even deconstruction of their meaning in the two texts is the tool that helps to answer this question. The examination of these terms is intertwined and woven with threads that start from Pyrrhonian thought and reach up to the Ciorian approach to the "triple dead end" ("dreifache Sackgasse") of human nature. It is demonstrated that any contradiction of these terms comes from the constantly historically changing use of terms and the fact that in the novel the apparently contradictory use of terms is nothing more than the use of the same terms in the light of the differentiation of their meaning over time. In this sense, the text of Cioran's doctrine of decay proves to be a crucial aid in helping to decode the apparent contradictions in the novel and to effectively prove that they are not in real opposition. This area of research also includes the ambiguous and related concepts of development and progress, as well as those of the primitive, the ideal and the idealized that are found in both works. In this research, the attacks of both texts on society, politics and politicians are analysed against one another. The same is done with their stormy discourses against religion and especially against religious fanaticism. The themes of fanaticism, violence, war and national socialism associated with Catholicism in the novel are analysed in relation to the respective positions on violence, religious fanaticism and the inherent prophetic nature of every human being as the root of evil, which are discussed in this philosophical work of Cioran. Furthermore, Murau's critique of the German language is analyzed in relation to Cioran's insight into the general deterioration of every language through its "maximum use/ abuse" [CIO 194]. This is explored in the context of the section, which studies the terms of development and progress. Through a systematic study of all these issues, the question posed at the outset, whether Thomas Bernhard's novel "Extinction" can be considered a literary textbook/ a literary teaching of decay in the Ciorian sense, is answered in a substantiated manner.
show more
Abstract
In der Dissertation wird systematisch untersucht, ob der Roman „Auslöschung" von Thomas Bernhard als eine literarische „Lehre vom Zerfall“ in Anlehnung an Ciorans Werk verstanden werden kann. Es wird untersucht ob die paratextuelle Vorausdeutung „Ein Zerfall“ im Untertitel des Romans „Auslöschung" vonThomas Bernhard als grundlegendes Mittel der Rezeptionslenkung angesehen werden darf. Es wird systematisch erläutert, worauf sich der im Untertitel erwähnte Zerfall beziehen kann, welche die semantische Reichweite dieses Begriffs ist. Der Oberbegriff des Zerfalls umfaßt verschiedene verwandte Bedeutungen wie beispielsweise Fäulnis, Verfall, Korruption. Darauf wird in Anlehnung an „Auslöschung" eingegangen. Als erstes werden die Erscheinungsformen des Zerfalls in „Auslöschung" aufgefunden, im Grunde kategorisiert und anhand der Cioranischen "Lehre vom Zerfall" untersucht. In welcher Beziehung steht der Begriff des Zerfalls so wie er in Bernhards Roman angewendet wird zu dem des philosophis ...
In der Dissertation wird systematisch untersucht, ob der Roman „Auslöschung" von Thomas Bernhard als eine literarische „Lehre vom Zerfall“ in Anlehnung an Ciorans Werk verstanden werden kann. Es wird untersucht ob die paratextuelle Vorausdeutung „Ein Zerfall“ im Untertitel des Romans „Auslöschung" vonThomas Bernhard als grundlegendes Mittel der Rezeptionslenkung angesehen werden darf. Es wird systematisch erläutert, worauf sich der im Untertitel erwähnte Zerfall beziehen kann, welche die semantische Reichweite dieses Begriffs ist. Der Oberbegriff des Zerfalls umfaßt verschiedene verwandte Bedeutungen wie beispielsweise Fäulnis, Verfall, Korruption. Darauf wird in Anlehnung an „Auslöschung" eingegangen. Als erstes werden die Erscheinungsformen des Zerfalls in „Auslöschung" aufgefunden, im Grunde kategorisiert und anhand der Cioranischen "Lehre vom Zerfall" untersucht. In welcher Beziehung steht der Begriff des Zerfalls so wie er in Bernhards Roman angewendet wird zu dem des philosophischen Textes? Überschneiden sich die Erscheinungsformen des Zerfalls in beiden Werken? Folgen sie gewissermaßen derselben Logik? Lassen sie sich identifizieren, ergänzen sie einander oder stehen sie gegeneinander in konträrer Beziehung?
In jeder Einheit wird somit ein kontrastives Experiment befolgt. Jede den Zerfall untersuchende Einheit wird im Vergleich zu Ciorans „Lehre vom Zerfall" betrachtet. Somit wird die Bedeutungsbreite des Zerfallbegriffes in „Auslöschung" im direkten Bezug zu Ciorans philosophischem Text untersucht. Dadurch werden die Gemeinsamkeiten und die Divergenzen sichtbar. Dabei wird nicht auf eine Beziehung von Grund und Folge, nämlich in dem Sinne des möglichen Einflußes von Cioran auf Bernhard eingegangen, sondern der Fokus ist auf die Betrachtung und Analyse des Zerfalls als Schlüsselbegriff im Roman aufgrund der Cioranischen „Lehre vom Zerfall". Es wird systematisch untersucht, ob die „Lehre vom Zerfall" als philosophisches interpretatorisches Mittel des Romans dienen kann und parallell dazu auf das einander ergänzende Verhältnis eingegangen, in ganz ähnlichem Sinne wie die Theorie und die Praxis in einer mathematischen Übung zueinanderstehen. In diesem Sinne prüfe ich, ob diese beiden Werke zusammen ein gewissermaßen vollständiges Handbuch über den Zerfall darstellen können. Es wird dabei von Muraus Angst vor dem Zerfall ausgegangen und vorherrschende Nuancen des Zerfalls im Roman in Anlehnung an Ciorans „Lehre vom Zerfall" untersucht. Es wird der Frage nachgegangen, ob die ambivalenten makabren Vorstellungen der zerfallenen Materie und der Verwesungsvorgänge für beide Autoren Schritt für Schritt zur Genesung vom Todeswahn führen könnten. Hinweise für diese Vermutung werden im Werk Bernhards und Ciorans gemacht. Die Krankheit als ein zum Zerfall des Körpers führender Faktor ist ein gemeinsames Hauptthema. Eine grundlegende Meinung des Protagonisten der „Auslöschung" ist, dass ständige Bewegung erforderlich ist, damit die Stagnation und der sich daraus ergebende Zerfall vermieden werden. In „Lehre vom Zerfall" hingegen wird die ständige Bewegung abwertend als „Tatendrang“ [CIO 11] bezeichnet. Cioran argumentiert über die „Heiligkeit des Müßiggangs“ [CIO 59]. Es wird bearbeitet, ob es sich dabei um eine Kluft in der Herangehensweise an diese Begriffe in den beiden Werken handelt und ob die Langeweile, der Tatendrang, der Müßiggang, die Inquietät, die Zerstreuung, die Trägheit (Acedia) als Träger der Ruhe und der Unruhe trotz der anscheinenden Unterschiede ähnlich in beiden Werken verwendet werden. Der Frage wird nachgegangen, ob sie Gegenbegriffe in beiden Werken sind oder es um eine Dekonstruktion ihres angenommenen Sinnes geht Zu diesem Untersuchungsgebiet gehören auch die in beiden Werken vorkommenden ambivalenten Begriffe der Entwicklung und des Fortschritts sowie des Primitiven, des Ideals und des Idealen. Im Rahmen dieser Untersuchung werden beispielsweise die Attacken beider Texte gegen die Gesellschaft, die Politik und die Politiker kontrastiv analysiert. Das gleiche geschieht mit ihren stürmenden Reden gegen die Religion und vor allem gegen den religiösen Fanatismus. Die Themen des Fanatismus, der Gewalt, des Krieges und des mit dem Katholizismus verknüpften Nationalsozialismus im Roman werden in Anlehnung an das philosophische Werk Ciorans untersucht. Zusätzlich wird Muraus Kritik an der deutschen Sprache in Verbindung mit der Cioranischen Einsicht in den Verfall der Sprache durch „die äußerste Verbrauchtheit“ [CIO 194] untersucht. Das wird im Rahmen der Thematik der Entwicklung und des Fortschritts erörtert. All diese Themenbereiche untersuchend wird der Frage nachgegangen, ob die Auslöschung als eine literarische „Lehre vom Zerfall“ im Cioranischen Sinne verstanden werden kann.
show more